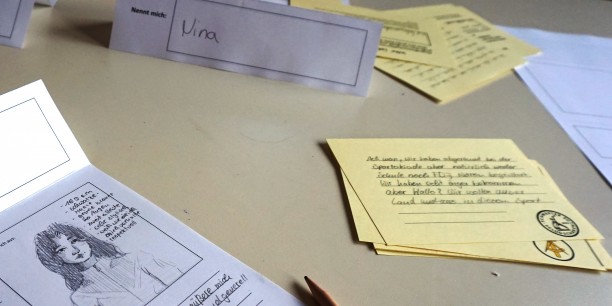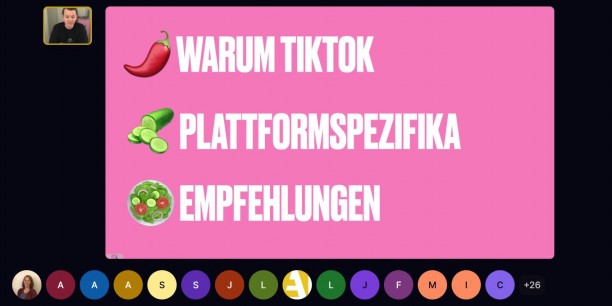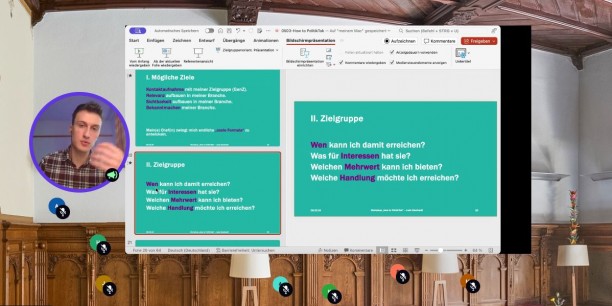Jubiläum: 10. Thüringer Arbeitszeitkonferenz 2024

Bildserie zur 10. Jubiläumsausgabe der Thüringer Arbeitszeitkonferenz. Eröffnung durch Julia Langhammer (DGB) und Frank Fehlberg (EKM). Foto: EAT 
Einer der Impulsvorträge: Wie kann Sorgearbeit gerecht unter den Geschlechtern aufgeteilt werden? Friederike Theile, Geschäftsführerin des Landesfrauenrats Thüringen. Foto: EAT 
In kleinen Runden konnten die Teilnehmenden den eingeladenen Politiker*innen im direkten Austausch gegenübertreten. Hier: Thadäus König (CDU), MdL. Foto: EAT 
Arbeitszeitkonferenz-Urgestein und Mitorganisator Bernd Spitzbarth (IG Metall Nordhausen, an der Tafel) im Gespräch mit Diana Lehmann (SPD), MdL (rechts, stehend). Foto: EAT 
Die offene Atmosphäre der Tischrunden kam gut an. Im Gespräch war auch Ann-Sophie Bohm (rechts), Landessprecherin Bündnis 90/Die Grünen. Foto: EAT
Jubiläen wecken oftmals den Eindruck der althergebrachten Selbstverständlichkeit. In vielen Fällen werden sie genau auf diese Wirkung hin demonstrativ und symbolträchtig inszeniert. Bei der 10. Thüringer Arbeitszeitkonferenz am 21. und 22. März 2024 ging es jedoch weniger pompös zu, als vielmehr fokussiert und betriebsam. Von einer Zufriedenheit mit Erreichtem und einem verdienten Ausruhen war im 30. Jahr des Bestehens des deutschen Arbeitszeitgesetzes – ein weiteres Jubiläum – nichts zu spüren. Es gibt viel zu tun.
Streikrecht einschränken, Feiertage streichen – Ist das „Aufwertung“ der Arbeit?
Frank Fehlberg, Studienleiter für Arbeit und Wirtschaft an der Evangelischen Akademie Thüringen und Referent für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, machte zur Eröffnung mit einem Zitat aus der Geschichte der Arbeitszeitpolitik noch einmal darauf aufmerksam, dass Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit nicht nur individuelle Grundbedürfnisse berühren, sondern Kernfragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts sind.
- „Der Kampf um die 35-Stunden-Woche ist daher weit mehr als ein nur ökonomischer Kampf. Er ist ein Kampf um die Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse.“
Franz Steinkühler 1983, IG Metall-Vorsitzender 1986-1993, „Vater der 35-Stunden-Woche“
Wer etwa den Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche im Konflikt zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) als „übertrieben“ einschätze, solle sich die Entwicklung der DB seit ihrer Wandlung vom Staatsbetrieb mit Gemeinwohlverantwortung zum privatwirtschaftlichen Konzernbetrieb mit Gewinnorientierung anschauen. Die Nachteile, die diese sozial und wirtschaftlich zentrale Infrastruktur und ihr Betriebspersonal dadurch erlitten hätten, seien „Legende“. Die langmütige Selbstironie von DB-Mitarbeitenden sei „betriebliche Übung“ geworden.
30 Jahre Arbeitszeitgesetz und Abschaffung Buß- und Bettag
Das Arbeitszeitgesetz war 1994 in Folge einer Europäischen Richtlinie erlassen worden. In dieser hieß es 1993: „Die Verbesserung von Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit stellen Zielsetzungen dar, die keinen rein wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden dürfen.“
1994, also im selben Jahr des Inkrafttretens des Arbeitszeitgesetzes, wurde auch beschlossen, den Buß- und Bettag für die Finanzierung der Pflegeversicherung zu streichen. Das „Bußtagsopfer“ der „kleinen Leute“ in Form von Mehrarbeit hatte keinen nachhaltigen Finanzierungseinfluss. Aber die Idee der Umwandlung von Ruhe- in Werktage lebt nach wie vor fort und sie wird wieder aufgewärmt. Etwa 45 Tagungsteilnehmende waren sich weitgehend einig, dass Errungenschaften im Arbeitszeitrecht nicht ohne erneute Anstrengungen zu halten oder bei hoher gesamtwirtschaftlicher Produktivität auszubauen sind.
Den Mammon nicht besänftigt: Sind neue „Bußtagsopfer“ nötig?
Der Ökonom Guntram Wolff forderte Ende 2023 im Handelsblatt zur Einstimmung auf das Superwahljahr 2024 konkret die Abschaffung weiterer zwei Feiertage, um eine „strukturelle Lücke“ in den Staatsausgaben zu füllen. Die auf sozialer und ökonomischer Betriebsblindheit basierende „Schuldenbremse“ im Grundgesetz ließ er angesichts des nötigen strategischen Wirtschaftswandels nahezu unhinterfragt stehen. Dabei wirkt sie als eine verheerende Investitions- und Handlungsbremse des Staates und ist zugleich der Beschleuniger von privaten Großinteressen auf den „neuen Märkten“ der sozial-ökologischen Transformation.
Mehr Zeitwohlstand: Gelebte Demokratie setzt Lebensperspektiven voraus
Die Atmosphäre auf der 10. Arbeitszeitkonferenz fiel angesichts des zunehmend gegenläufigen Arbeitszeitdiskurses insgesamt kämpferisch aus: Eine Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen darf nicht einseitig zu Lasten des arbeitenden Rückgrats der Gesellschaft erfolgen – einschließlich der (familiären) Sorge- und Gemeinschaftsarbeit sowie des ehrenamtlichen Engagements einer zunehmend als sozialpolitische Lückenbüßerin vorgeschobenen Zivilgesellschaft! Wer die Lebensperspektiven dieser Mehrheit dem (Arbeits-)Markt überlässt, erweist der Verteidigung der gelebten Demokratie einen Bärendienst.
Das Jubiläums-Fazit des Studienleiters Frank Fehlberg: Wohlstand heißt nicht primär „Steigerung des Bruttosozialprodukts“. Wohlstand bedeutet, viel Zeit als Mensch für Menschen zu haben.
Veröffentlicht am 24. März 2024